"Die ökologische Wende braucht unser Herz"
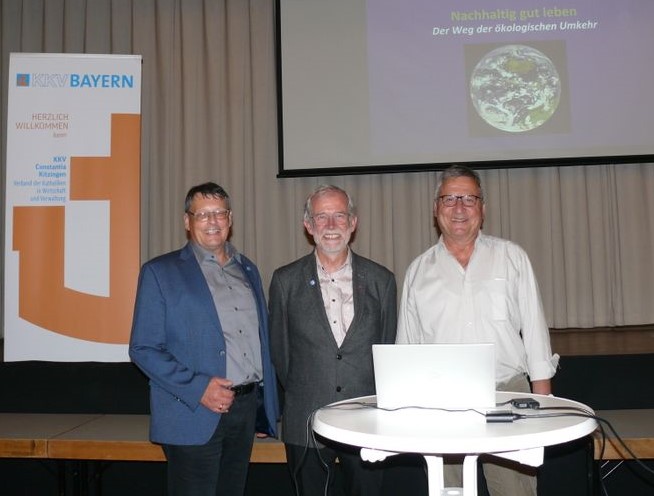
Prof. Michael Rosenberger sprach in Kitzingen über den Weg aus dem Klimawandel
„Der Weg der ökologischen Umkehr ist ein Weg, der unser Herz braucht.“ Das war das Fazit, das Prof. Dr. Michael Rosenberger am Ende seines Vortrages zog. Auf Einladung des KKV Constantia Kitzingen sprach der Moraltheologe zum Thema „Nachhaltig gut leben – der Weg zur ökologischen Wende“.
Mit diesem Thema sprach er offensichtlich das Interesse vieler an. Rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer waren ins katholische Dekanatszentrum gekommen.
Prof. Rosenberger stammt aus Kitzingen; er studierte in Würzburg und Rom Theologie und lehrt seit vielen Jahren an der Katholischen Privat-Universität Linz Moraltheologie. 2004 wurde er in die österreichische Gentechnik-Kommission berufen. Ein Schwerpunkt seiner Forschungen bilden Fragen der Schöpfungsethik und Schöpfungsspiritualität.
An den Beginn seines Vortrags stellte Rosenberger die Fridays-for-future-Bewegung, in der junge Menschen versuchen, Druck auf Politiker und Staatenlenker zu erzeugen, sich vermehrt dem dringlichen Problem der Klimaveränderungen auf unserem Planeten zu widmen. Anhand der sogenannten 9 planetarischen Grenzen wies er darauf hin, dass sich die Erde in drei Bereichen bereits in einem katastrophalen Zustand befindet, und zwar beim Phosphor-und Stickstoffgehalt in Gewässern, bei der Bio-Diversität und bei der Belastung mit Plastik und Kunststoffen. Schlüsselindikatoren seien in jedem Fall der Verlust der Artenvielfalt und die überall spürbaren klimatischen Veränderungen.
Das Klimaproblem bezeichnete Rosenberger als Tatsache, die durch jahrhundertealte Wetteraufzeichnungen belegt wird und die seit den 1950er Jahren eine rasante Entwicklung genommen habe. Das Wirtschaftswunder habe dem Menschen zwar Wohlstand und Bequemlichkeit gebracht, dem Ökosystem der Erde aber nicht gutgetan. Unmittelbare Folgen des klimatischen Wandels seien Dürre, Stürme und Überflutungen, die sich auf Ernährung und Wasserversorgung auswirkten. Als daraus resultierende mittelbare Auswirkungen nannte der Referent Millionen von Umweltflüchtlingen sowie Kriege um Ressourcen.
Obwohl das Klimaproblem als solches erkannt werde und es auch bereits Maßnahmen zur Einsparung von Energien gebe, würden „Erfolge“ oft unterlaufen durch den sogenannten Rebound Effekt. Ihn erklärte Rosenberger wie folgt: Die Einsparungen, die auf der einen Seite gemacht werden, können durch ein verändertes Nutzungsverhalten keine Effizienz entfalten. So werde beispielsweise die Verbesserung der Heiztechnik durch Zuwachs des beheizten Wohnraums konterkariert. Die Einsparung von Benzin durch bessere Automotoren werde durch den Bau immer größerer und schwererer Autos und die generelle Zunahme der Zahl an Kraftfahrzeugen aufgefressen.
Wirksame Gegenmaßnahmen sieht Prof. Rosenberger vor allem in einer Änderung des Lebensstils und in gezielten Preiserhöhungen. Ziel müsse sein, das für Klima und Umwelt Gute oder Bessere verfügbar, erkennbar und leichter bezahlbar zu machen als die Dinge, die sich negativ auswirken. Als mögliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang nannte Rosenberger eine Öko-Steuer und Emissionszertifikate. Für Investitionsentscheidungen sei dabei auf eine mittelfristige Berechenbarkeit zu achten; außerdem dürfe es keinesfalls Gratis-Zertifikate geben. Alle staatlichen Regelungen müssten sich an ihrer Klimawirkung messen lassen und sämtliche Wirtschaftssektoren erfassen, also sowohl Industrie und Verkehr als auch Landwirtschaft und private Haushalte. Gleichzeitig und in gleichem Maße müssten andere Abgaben gesenkt werden, so dass die Belastungen für den Einzelnen nicht ins Uferlose steigen. Dem Klimaschutz sei absolute Priorität einzuräumen. Staatliche Lenkungsmaßnahmen genügten aber nicht, jeder Einzelne sei gefragt. Und in besonderem Maße auch die Kirchen.
Als „wahren Schatz“ bezeichnete der Referent die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus. Sie enthalte viele tiefgehende Überlegungen und Aussagen. In der Änderung unseres Umweltverhaltens sieht der Papst eine „mutige, kulturelle Revolution“, die in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen von höchster Dringlichkeit ist. Er verstehe, so Rosenberger, die Umweltkrise als Aufruf zu einer inneren Umkehr; sie betreffe jeden Einzelnen und müsse aus dem Herzen, gemeinschaftlich und ganzheitlich erfolgen.
Das Kirchenoberhaupt sehe in der Genügsamkeit (Suffizienz) den Schlüssel zur Nachhaltigkeit. In einer sehr realistischen Betrachtungsweise entlarve er die Vorgabe eines stetigen Wachstums als Illusion; es könne nicht immer höher, weiter, besser gehen, denn die Wirklichkeit setze Grenzen. Vielmehr sei die Orientierung an einem wirklichen Gemeinwohl erforderlich. Dabei seien Begriffe wie Gerechtigkeit, Maßhalten und Gelassenheit von Bedeutung. Der Mensch müsse wieder ein Gefühl von Ehrfurcht und Demut angesichts des Wunderwerks Schöpfung entwickeln und in Dankbarkeit ihren unermesslichen Wert neu schätzen lernen. Dazu gehöre auch die Fähigkeit, zu genießen und sich am Geschenk des Lebens zu freuen.





